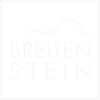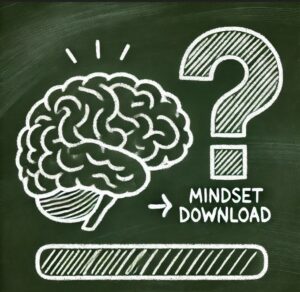Warum wir Generationenkonzepte kritisch betrachten sollten
Der Diskurs über Generationen wie X, Y und Z ist allgegenwärtig. Personalabteilungen, Führungskräfte und Medien kategorisieren Menschen in Generationenschubladen mit vermeintlich typischen Eigenschaften. Doch wie tragfähig sind diese Konzepte wirklich? Ist eine Person der Generation Z tatsächlich grundsätzlich anders als jemand aus der Generation X?
Eine kritische Betrachtung zeigt: Die beliebten Generationenkonzepte weisen erhebliche wissenschaftliche Schwächen auf. Der Jugendforscher Simon Schnetzer betont, dass „Generation Z“ eigentlich keine Generation bezeichnet, sondern lediglich ein Label für eine Alterskohorte darstellt. Diese begriffliche Unschärfe zieht sich durch die gesamte Generationendebatte.
INFOBOX: Alters-, Perioden- und Kohorteneffekte
Die Forschung unterscheidet zwischen verschiedenen Effekten, die oft fälschlicherweise als Generationsunterschiede interpretiert werden:
- Alterseffekte: Eigenschaften und Verhaltensweisen, die mit dem Lebensalter zusammenhängen
- Periodeneffekte: Einflüsse durch zeitgeschichtliche Ereignisse, die alle Altersgruppen betreffen
- Kohorteneffekte: Nur diese sind tatsächlich generationsspezifisch und entstehen durch prägende Erfahrungen einer Altersgruppe
Systematische Übersichten und Längsschnittanalysen zeigen, dass vermeintliche „Generationsunterschiede“ häufig durch Alters- und Periodeneffekte erklärbar sind; echte Kohorteneffekte sind seltener, kontextspezifisch und müssen empirisch nachgewiesen werden. Zudem überschätzen Querschnittdesigns Unterschiede, weil Alter und Kohorte oft konfundiert sind. Für arbeitsbezogene Einstellungen bestätigt eine Meta-Analyse geringe bis vernachlässigbare Generationsunterschiede (Costanza et al. 2012). Neuere Arbeiten erweitern den Befundraum und unterstreichen konzeptionelle und methodische Grenzen der Generationenforschung (Costanza et al., 2012; Ravid et al., 2024/2025).
Warum wir dennoch an den Generationenlabels festhalten
Trotz aller wissenschaftlichen Einwände gegen Generationenkonzepte bleiben die Begriffe X, Y und Z im allgemeinen Sprachgebrauch verankert. Dafür gibt es verschiedene Gründe:
- Die Begriffe sind bereits etabliert und weithin bekannt
- Sie bieten eine vermeintlich einfache Erklärung für komplexe soziale Phänomene
- Es fehlen praktikable und eingängige Alternativen
Die Kategorisierung in Generationen reduziert die Vielschichtigkeit menschlicher Unterschiede auf einige wenige, leicht kommunizierbare Kategorien. Dies erscheint besonders in Management- und Marketingkontexten attraktiv, auch wenn diese Vereinfachung wissenschaftlich problematisch ist. Kritische Übersichtsbeiträge fassen diese Risiken zusammen (Costanza et al., 2012; Costanza, 2015).
INFOBOX: Der Grundkonflikt der Generationenforschung
In der Generationenforschung existiert ein fundamentaler Widerspruch:
- These: Die Komplexität der Welt lässt sich in Generationen erfassen
- Antithese: Die Wirklichkeit ist zu komplex für eine Kategorisierung in Generationen
Diese Spannung begleitet die gesamte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Generationenkonzept.
Marc Raschke betont in seiner Kritik, dass pauschale Aussagen grundsätzlich problematisch sind – unabhängig davon, um welche Generation es sich handelt. Die Lebensphasen, Bedürfnisse und das Mindset jedes Menschen sind zu individuell, um sie in ein starres Generationenraster zu pressen.
Lebensphasenorientierung als tragfähige Alternative
Als Alternative gewinnen lebensphasenorientierte Modelle an Bedeutung. Die öffentliche Verwaltung in Deutschland und die Bundesagentur für Arbeit (BA) verankern ein demografiesensibles, lebensphasenorientiertes Personalmanagement und differenzieren vier typische Phasen mit fließenden Übergängen. Eine anschauliche Kurzbeschreibung der vier Phasen findet sich auch im Praxisreport (mit BA-Bezügen) (BMI/BA, 2012; BA, 2024; INQA, 2014).
Diesem Ansatz liegt die Erkenntnis zugrunde, dass sich im Laufe des Lebens Bedürfnisse und Erwartungen ändern, Erwerbsbiografien zunehmend weniger linear verlaufen und sich verändernde Lebenssituationen anerkannt werden müssen.
Der lebensphasenorientierte Ansatz bietet mehrere Vorteile:
- Er berücksichtigt die individuelle Entwicklung jedes Mitarbeitenden
- Er erkennt an, dass Menschen innerhalb einer Alterskohorte unterschiedliche Lebenssituationen haben können
- Er ermöglicht eine flexiblere Anpassung an sich verändernde Bedürfnisse im Laufe eines Arbeitslebens.
INFOBOX: Das Vier-Phasen-Modell der Bundesagentur für Arbeit
- Phase 1: Schulische/berufliche Ausbildung bzw. Studium
- Phase 2: Berufseinstieg, Karrierestart und erste Familienphase
- Phase 3: Vertikale/horizontale Karriereentwicklung, Pflegethemen bzw. Rückkehr aus längerer Familienphase
- Phase 4: Aktiver Ruhestand
Die Übergänge zwischen den Phasen sind fließend und individuell unterschiedlich (BMI/BA, 2012; BA, 2024).
Praktische Strategien für eine lebensabschnittsorientierte Personalarbeit
Wie kann ein Unternehmen konkret eine lebensphasenorientierte Personalarbeit umsetzen? Hier einige praktische Ansätze:
Analyse und Planung als Grundlage
Für eine effektive lebensabschnittsorientierte Personalarbeit ist eine gründliche Analyse der bestehenden Situation unerlässlich:
- Altersstrukturanalyse: Durchführung einer Analyse, um die aktuelle Altersverteilung zu erfassen
- Zukunftsprognose: Erstellung einer Prognose für die nächsten fünf bis zehn Jahre
- IST-Analyse: Evaluierung der bereits umgesetzten lebensphasenorientierten Maßnahmen
Dialog und Sensibilisierung
Die Förderung des Dialogs und die Sensibilisierung für unterschiedliche Bedürfnisse sind zentrale Elemente:
- Dialog-Workshops zwischen unterschiedlichen Altersgruppen
- Führungskräftesensibilisierung für lebensphasenspezifische Bedürfnisse
- Lebensphasenspezifische Auswertung von Mitarbeiterbefragungen
Konkrete Maßnahmen für verschiedene Lebensphasen
Für die frühe Karrierephase:
- Regelmäßige Feedbackgespräche in kurzen Abständen
- Flexible Arbeitsmodelle
- Schaffung von Räumen für Kollegialität und Gemeinschaftsbildung
Für die mittlere Karrierephase mit Familienverantwortung:
- Lebensphasenorientierte Arbeitszeitmodelle
- Wiedereinstiegsprogramme nach der Elternzeit
- Unterstützung bei der Kinderbetreuung
Für die späte Karrierephase mit möglicher Pflegeverantwortung:
- Perspektivgespräche zum Übergang in den Ruhestand
- Pflegefreundliche Arbeitszeiten
- Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung
- Systematischer Wissenstransfer
Übergreifende Strategien für alle Lebensphasen
- Mentoring und Lerntandems zwischen verschiedenen Altersgruppen
- Altersdiverse Teamzusammensetzung
- Lebensphasengerechte Weiterbildungsangebote
- Individualisierte Anreizsysteme
Hinweis auf Evidenz:
- Flexible Arbeitszeit-/Arbeitsortmodelle stehen in Zusammenhang mit höherer Work-Life-Balance und Engagement; es gibt aber auch Risiken (Grenzverwischung), die durch klare Regeln adressiert werden sollten (Eurofound, 2019/2020; Kröll & Nüesch, 2017).
- Reviews zeigen positive Effekte flexibler Modelle auf Bindung/Retention, abhängig von Gestaltung und Kontext (Wong et al., 2020).
- Überblicksarbeiten zeigen, dass Engagement mit besseren individuellen Outcomes einhergeht und durch Arbeitsgestaltung (inkl. Autonomie/Flexibilität) gefördert werden kann (Schaufeli/Mazzetti et al., 2021).
Von der Generationendebatte zur individuellen Betrachtung
Die kritische Reflexion der Generation-XYZ-Diskussion zeigt: Statt starrer generationenbezogener Kategorisierungen ist ein lebensphasenorientierter Ansatz wissenschaftlich fundierter und praktisch nützlicher. Er berücksichtigt die Individualität der Beschäftigten, die Vielfalt ihrer Lebenssituationen und die dynamische Entwicklung ihrer Bedürfnisse.
Für Organisationen bedeutet dies einen Perspektivwechsel: Weg von der Frage „Wie gehen wir mit Generation X, Y oder Z um?“ hin zu „Wie können wir unsere Personalarbeit so gestalten, dass sie den individuellen Bedürfnissen in verschiedenen Lebensphasen gerecht wird?“.
Die größte Herausforderung liegt darin, die Balance zu finden zwischen einer strukturierten, systematischen Herangehensweise und der notwendigen Flexibilität für individuelle Unterschiede. Der Schlüssel zum Erfolg ist ein kontinuierlicher Dialog mit den Beschäftigten und eine ständige Anpassung der Maßnahmen an deren sich verändernde Bedürfnisse und Lebenssituationen.
So können wir den Mythos der Generationen hinter uns lassen und zu einer differenzierteren, wirksameren Personalarbeit gelangen, die Menschen in ihrer Einzigartigkeit und in ihren jeweiligen Lebensphasen wahrnimmt und fördert.
Wer neugierig ist und tiefer eintauchen möchte – hier findet ihr unsere Quellen, Ideen und Denkanstöße:
Costanza, D. P., Badger, J. M., Fraser, R. L., Severt, J. B., & Gade, P. A. (2012). Generational Differences in Work-Related Attitudes: A Meta-Analysis. Journal of Business and Psychology. https://link.springer.com/article/10.1007/s10869-012-9259-4
Ravid, D. M., et al. (2024/2025). Generational differences at work? A meta-analysis and qualitative investigation. Journal of Organizational Behavior, Preprint. https://werkvloeracademie.nl/wp-content/uploads/2025/06/J-Organ-Behavior-2024-Ravid-Generational-differences-at-work-A-meta%E2%80%90analysis-and-qualitative-investigation-1-1.pdf
Costanza, D. P. (2015). Generationally Based Differences in the Workplace: Is There a There There? https://www.researchgate.net/publication/282633751_Generationally_Based_Differences_in_the_Workplace_Is_There_a_There_There
BMI/BA (2012). Leitfaden lebensphasenorientierte Personalpolitik. https://www.verwaltung-innovativ.de/SharedDocs/Publikationen/Personal/leitfaden_lebensphasenorientierte_personalpolitik.pdf?__blob=publicationFile&v=1
BA (2024). Lebensphasen in der Personalentwicklung – Faktor A. https://www.arbeitsagentur.de/faktor-a/arbeitswelt-gestalten/lebensphasen-in-der-personalentwicklung
INQA (2014). Verwaltung der Zukunft – Praxisreport. https://www.quartier2030-bw.de/medias/inqa-verwaltung-der-zukunft-praxisreport-2014_4cbdd759ef79dd6db74b3c7a7df9bb3a.pdf
BMWK (2010/2013). Lebensphasenorientierte Personalpolitik. https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/lebensphasenorientierte-personalpolitik.pdf?__blob=publicationFile&v=1
Eurofound (2019/2020). Regulations to address work–life balance in digital flexible working arrangements. https://assets.eurofound.europa.eu/f/279033/4b28e7152a/ef19046en.pdf
Kröll, C., & Nüesch, S. (2017). Effects of flexible work practices on employee attitudes: Panel evidence (DE). Zitiert in Überblick: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11254825/
Wong, K., Chan, A. H., & Teh, P. L. (2020). Meta-analysis: Work–Life-Balance und Performance. https://ejournal.svgacademy.org/index.php/ijabmr/article/view/80
Schaufeli, W. B., Mazzetti, G., et al. (2021). Meta-Analyse zum JD-R-Modell und Engagement-Outcomes. https://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/597.pdf